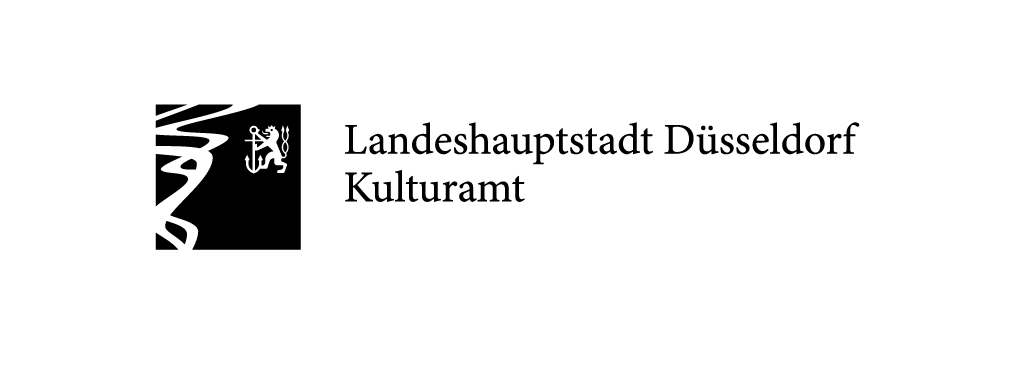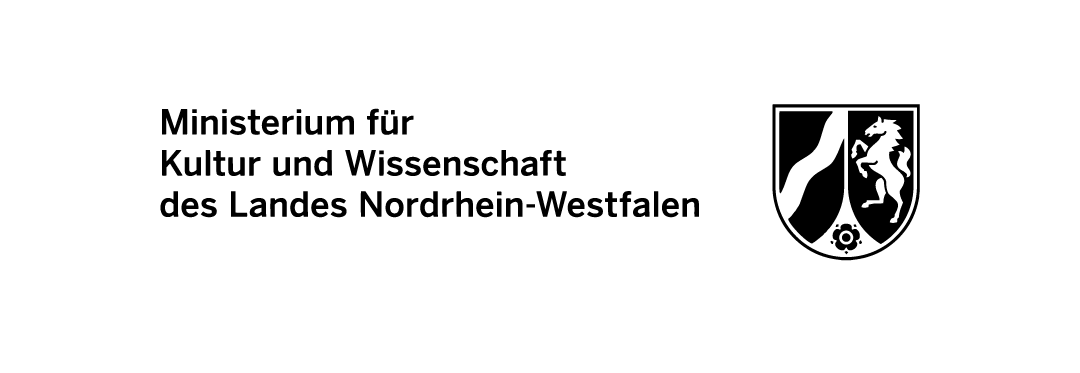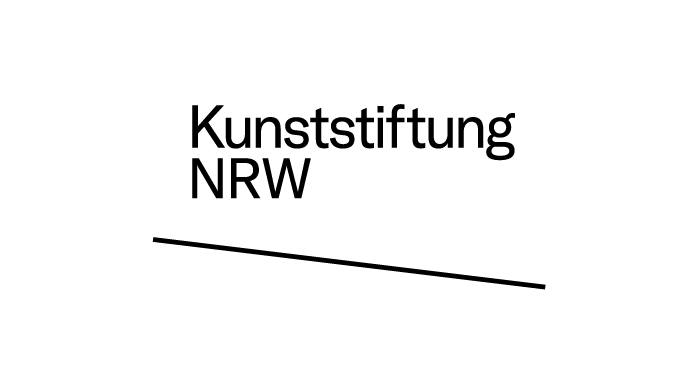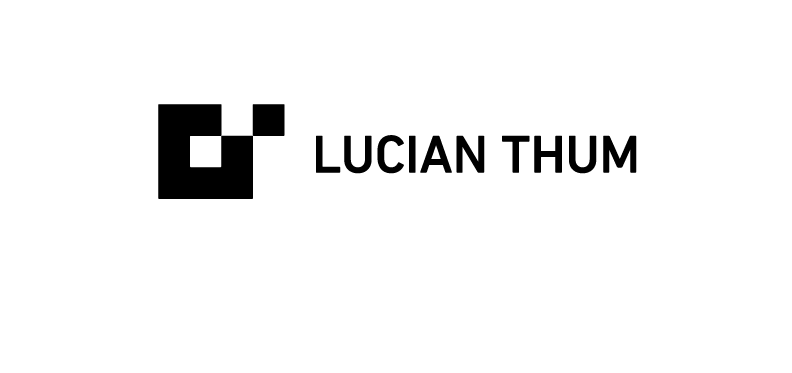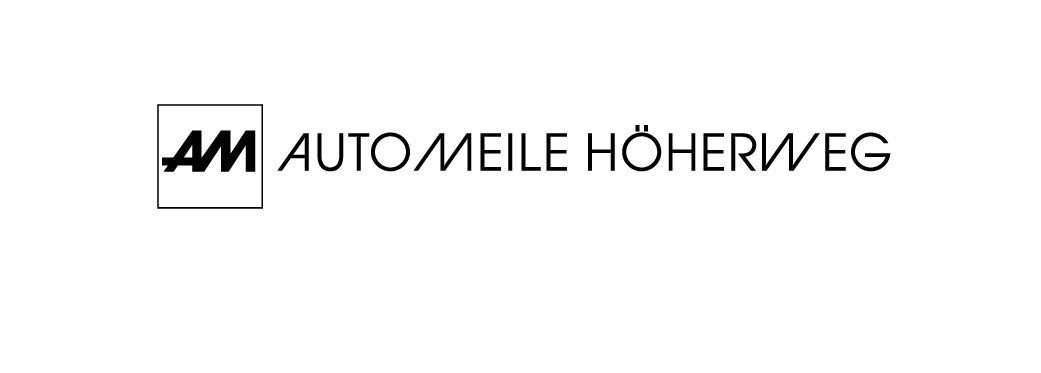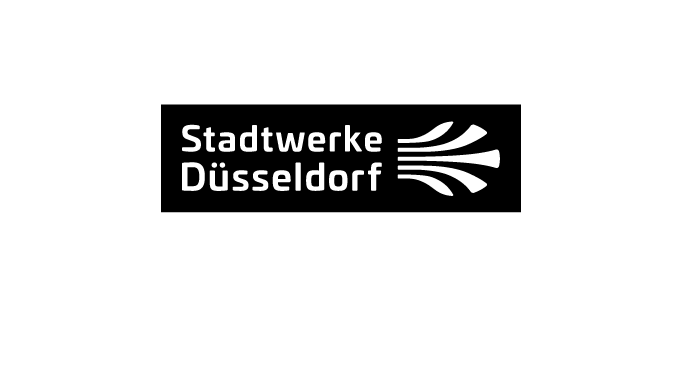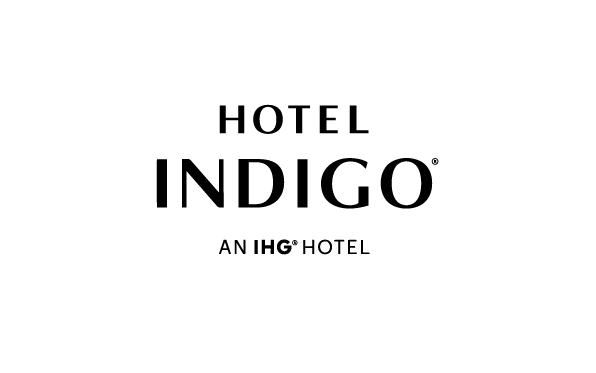Autorin und Dramaturgin Juliane Hendes über die Produktion ›Endstation fern von hier‹, künstlerische Arbeit im Kontext von geschichtlicher Aufarbeitung und blinde Flecken in der Erinnerungskultur.
– 27. Juni 2022
Nach ›Schwarz-helle Nacht‹ (2019), ›Aktion:Aktion!‹ (2020) und ›Im Process‹ (2021) endet mit ›Endstation fern von hier‹ unser Zyklus ›Historification›, in dem wir Ereignisse der nationalsozialistischen Zeit in Düsseldorf theatral aufgearbeitet haben. Er endet mit einer großen Herausforderung: Wie macht man dokumentarisches Theater ohne Dokumente?
Die Quellenlage und Berichte der Zeitzeug:innen für die vorangegangenen Projekte waren umfangreich, bewegend und zahlreich. So konnten wir verantwortungsbewusst und gezielt im Umgang mit diesen Dokumenten unsere Stücke entwickeln. Im Themenkomplex der Zwangsarbeit stellte sich uns die Sache anders dar. In den Archiven und Gedenkstätten fanden sich wenig Zeitzeug:innenaussagen, und die, die sich fanden, waren in der Tendenz sehr zurückhaltend in der Beurteilung des eigenen Schicksals. Ganz so, als erlaube man sich nicht, das eigene Unrecht anzuklagen. Als würden die Betroffenen in dem Wissen um das Leid der Anderen ihr eigenes relativieren. Da stellte sich uns als Kollektiv die Frage: Warum hat die Erinnerung an die Zwangsarbeitenden des NS-Regimes in unserer Erinnerungskultur nie ihren Platz eingenommen? Und woran muss in diesem Zusammenhang überhaupt erinnert werden?
Rückblick: Zwangsarbeit in Düsseldorf und Deutschland
1941 – deutsche Soldaten marschieren in die Sowjetunion ein, belagern und plündern, was sich vor ihnen auftut und verpflichten – vor allem junge Menschen – zum Arbeitseinsatz. »In der Reihenfolge der Überfälle wurde die betroffene Zivilbevölkerung erst angeworben und als das nicht ausreichend Reaktionen nach sich zog, zum Arbeitseinsatz im deutschen Reich gezwungen«, so Joachim Schröder vom Erinnerungsort Alter Schlachthof. Er hat zusammen mit Rafael R. Leissa eine umfangreiche Arbeit zum Thema Zwangsarbeit in Düsseldorf vorgelegt und uns während unserer Arbeit mit seinem Wissen begleitet.
Aus ganz Europa kamen die Menschen nach Deutschland: »Der faschistische Staat bestand zu einem sehr großen Teil aus Zwangsarbeit. Viele Menschen waren an der Front oder schon gefallen. Ohne Zwangsarbeit wäre Deutschland nicht organisierbar gewesen», so Schröder weiter.
Für die Firmen war es eine wirtschaftliche Abwägung. Um die Geschäfte weiterführen zu können, brauchte es Mitarbeiter:innen und die waren auf anderem Weg nicht mehr zu kriegen. »Es sind mir keine Fälle bekannt, in denen sich eine Firma geweigert hätte, Menschen für sich arbeiten zu lassen, nur weil sie gezwungen wurden.«
Nach Düsseldorf kamen vor allem Menschen aus der Ukraine, da die Anwerbebezirke entsprechend zugeteilt worden sind. In diesem Zusammenhang ist die ehemalige Gauhauptstadt eine Stadt von vielen. Die genaue Zahl der Zwangsarbeitenden ist dabei schwer zu bestimmen, weil die gesamte deutsche Wirtschaft einer Art Zwangsarbeit unterlag. Auch deutsche Arbeiter:innen konnten nicht einfach arbeiten, wo sie wollten. In Düsseldorf gab es über das gesamte Stadtgebiet verteilt circa 300 Unterkünfte, aber nicht alle Betroffenen haben in Lagern gelebt. Einige lebten auch direkt in den Firmen oder in Familienhäusern. Man kann aber davon ausgehen, dass die Menschen so zahlreich waren, dass sie als Teil des Stadtbildes niemandem verborgen geblieben sein konnten.
Rassismus und Kontinuität
»Was bei der Beschäftigung mit Zwangsarbeit in der NS-Zeit besonders ins Auge fällt, ist die Kontinuität mit der auf Ausländer:innen in Deutschland geblickt wird. Der Vergleich mit den sogenannten ›Gastarbeitern‹ der 50er- und 60er-Jahre drängt sich da zum Beispiel auf. Sie haben in ›Fremdarbeiterlagern‹ gelebt, sie wurden also auch kaserniert, sollten auch unter sich bleiben, hatten deutlich weniger Rechte und mussten die Arbeit machen, die niemand machen wollte und wurden dafür auch noch schlechter bezahlt«, so Schröder.
Und auch heute noch machen immer wieder prekäre Arbeitsverhältnisse ausländischer Arbeitskräfte Schlagzeilen. Das nationalsozialistische Regime hat eine Hierarchie der Nationalitäten etabliert, die sich zum Teil bis heute hält. Nach ihrer Logik sind Menschen aus westlichen Staaten (Holland zum Beispiel) auch Germanen und damit ›rassisch wertvoller‹ als zum Beispiel Menschen italienischer Herkunft, die sich unter ihnen in der Hierarchie einreihten. Darunter wurden die slawischen Nationen einsortiert – sie galten als Arbeitsvölker und bolschewistische Untermenschen – und das Schusslicht bildeten aus nationalsozialistischer Sicht Jüdinnen und Juden und Sinti:zze und Rom:nja. »Das Ganze wurde begleitet von dieser typischen Nazibürokratie – Gesetzen sogar. Man beraubt die Leute ihrer Freiheit, diskriminiert, entrechtet und behandelt sie rassistisch und das wird dann in Gesetz und Verordnung gekleidet, damit es irgendwie legal aussieht«, berichtet Schröder als ein Ergebnis seiner umfangreichen Recherchen.
Insgesamt kamen so im ›Dritten Reich‹ mehr als 20 Millionen Menschen aus ganz Europa zu Schaden, davon waren 13,5 Millionen ausländische Zwangsarbeiter:innen, fünf Millionen kamen als sowjetische sogenannte ›Ostarbeiter‹ (Russ:innen, Ukrainer:innen, Belaruss:innen). Sie waren im Durchschnitt 18 Jahre alt. Auch Kinder wurden zur Arbeit eingesetzt. Lange Jahre mussten die ehemaligen Zwangsarbeiter:innen auf eine Entschädigung warten. Erst im Jahr 2000 wurde die Stiftung ›Erinnerung, Verantwortung und Zukunft‹ gegründet und leistete Entschädigungszahlungen an die Betroffenen (aus einem Gesamtbetrag von zehn Milliarden DM, gespeist aus Zahlungen vom Bund und den damals profitierenden Firmen). Zivilarbeiter:innen bekamen 5.000 DM, KZ-Häftlinge und Ghetto-Internierte 15.000 DM. Kriegsgefangene gingen leer aus, da es nach damaligem Recht erlaubt war, sie für den Arbeitseinsatz einzusetzen. »Für Menschen im Osten hat das Geld schon etwas gebracht. Gleichzeitig steht die Summe in keinem Verhältnis zu dem, was ihnen angetan worden ist«, konstatiert Schröder.
Wer gibt wem die Stimme? Wer die Impulse, um auch in die anderen Ecken der geschichtlichen Aufarbeitung genauer hinzuschauen? Und warum fehlen in unserem Erinnerungskanon mehr als 20 Millionen Stimmen? Wir als Theaterkollektiv Pièrre.Vers haben die zarten Impulse, die uns in der Recherche begegneten, aufgegriffen, verstärkt und vor allem in eine Figur fließen lassen: Valentina, die mit ihrer Geschichte eine von diesen 20 Millionen ist. Sie steht stellvertretend für all die Menschen, deren Geschichte bis heute ungehört blieb.

Juliane Hendes ist Autorin und Dramaturgin und schreibt für Theater, Film und Hörspiel. In Rostock geboren und aufgewachsen, studierte sie in Leipzig Dramaturgie an der Hochschule für Musik und Theater und arbeitete anschließend am Düsseldorfer Schauspielhaus als Regieassistentin. Seit 2016 ist sie freie Autorin und Dramaturgin und arbeitete unter anderem an den Sophiensälen Berlin, dem Nationaltheater Mannheim, den Münchner Kammerspielen und dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Als Autorin ist sie der freien Gruppe Pièrre.Vers assoziiert. 2021 wurde sie mit dem Förderpreis der Stadt Düsseldorf für Darstellende Kunst ausgezeichnet. Seit 2022 ist sie Teil von ›rua. – Kooperative für Text und Regie‹.